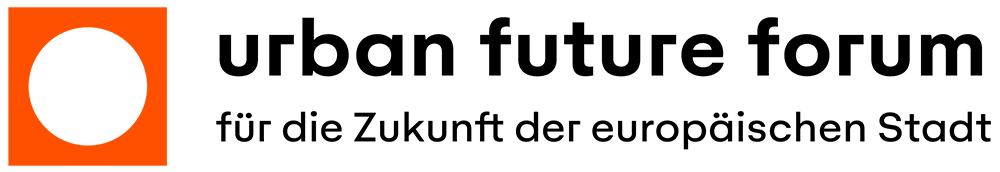„Die Relevanz des Gebauten“ – Umbaukultur
Die Bundesstiftung Baukultur hat mit ihrem jüngsten Baukulturbericht „Neue Umbaukultur“ die Richtung vorgegeben: Nachhaltige Architektur ist die Weiterentwicklung von Bestehendem. Umbau ist besser als Neubau. Doch was heißt das für den Berufsstand? Wie geht eine Gesellschaft mit missliebigen Gebäuden um?
Über die Verantwortung gegenüber dem baulichen Nachlass und einen Ethos des Häuserbauens in Zeiten des Klimawandels unterhalten sich am 28. November 2022 der schweizerische Architekt und Stadtplaner Patrick Gmür, der Jurist Dr. Thomas Schröer aus Frankfurt sowie der Architekt Prof. Dr. Paul Kahlfeldt aus Berlin.*
(*Eingeladen war auch die Präsidentin des Bundes Deutscher Architekten (BDA) Susanne Wartzeck, die leider kurzfristig absagen musste. Anm. d. Red.)
Aus programmatischer Sicht hätte es kaum einen besseren Ort für die zweite Veranstaltung der Symposiumsreihe „Für eine nachhaltige Architektur der Stadt“ geben können: Das Zwischenquartier des Deutschen Architekturmuseums (DAM) im ehemaligen Neckermann-Haus am Danziger Platz (Baujahr: 1951) ist ein sinnfälliges Beispiel für den Wert von Bestand, der sich den über Jahrzehnte wechselnden Anforderungen anpassen lässt und so zum Dach über dem Kopf ganz unterschiedlicher Nutzer wird.

Der Hausherr und Gastgeber des Abends, DAM-Direktor Peter Cachola Schmal, lässt es sich deshalb nicht nehmen, seine kurze Begrüßung auch für eine Selbstbezichtigung nutzen. So sei die Architektur eine Disziplin, die sich als genuine Schöpferin von Neuem, Besseren verstünde und dafür den bedenkenlosen Abriss von Bestehendem ebenso rechtfertigen konnte wie den immensen Verbrauch von Material und Energie – mit den bekannten Folgen für das Klima und die irdischen Ressourcen. Keine andere Wirtschaftsbranche hat eine vergleichbar schlechte Ökobilanz. Abriss und Neubau von Gebäuden ziehen Verheerungen nach sich, die ungleich größer sind, als der von Flugverkehr und Massentierhaltung verursachte Schaden. „Es gibt leider noch keine Abriss-Scham“, schließt Schmal unter Bezug auf den Rechtfertigungsdruck, dem sich beispielsweise Vielflieger, Fleischesser oder Halter großer Fahrzeuge ausgesetzt sehen.
„Wie beim Gebrauchtwagen gleicht ein Umbau meistens einer Bastelei“

Helmut Kleine-Kraneburg verwandelt die Feststellung des DAM-Direktors in eine zentrale Frage dieses Abends: „Wie erhaltenswert ist das, was wir heute bauen?“
In seiner thematischen Einführung geht er mit den programmatischen Ansätzen eines neuen, nachhaltigen Städtebaus kritisch ins Gericht: Holz, Modulbauweise, Recycling-Häuser. Doch ganz gleich, nach welcher Methode heute unsere Häuser und Städte entstehen, bemisst sich die Nachhaltigkeit architektonischer Hervorbringungen an ihrer Langlebigkeit. Und damit an ihrer Nutzungsoffenheit, Reparierbarkeit und ästhetischen Werthaltigkeit.
Wer als Architekt dem Umbau von Bestehendem den Vorzug gegenüber Abriss und Neubau gibt, müsse sich, so Kleine-Kraneburg, darüber im Klaren sein, dass bei einem Umbau im Idealfall das Alte und das Neue, Funktionierendes und Obsoletes zusammenkämen. Die Zumutung für den Architekten besteht freilich darin, dass er bei einem Umbau weniger als genuiner Schöpfer tätig wird, sondern als vielmehr als Bastler gefragt ist.
Doch wie kann das transformative Potenzial des Bestehenden entdeckt und besser genutzt werden, ohne dass sich Planung auf die rein physische und technische Ertüchtigung beschränkt?
Von der Bauordnung zur Umbauordnung

Darum soll es in der Diskussion gehen, der Dr. Thomas Schröer aus Frankfurt zunächst einen kompakten Vortrag über die anstehenden bau- und planungsrechtlichen Weichenstellungen voranstellt. Der Partner der Kanzlei FPS, zugleich Fachanwalt für Verwaltungsrecht, ist vorrangig auf dem Gebiet des öffentlichen Bau- und Planungsrechts tätig.
Im Grundsatz kreist der – mit „Umbau vor Neubau“ auf eine griffige Formel gebrachte – Paradigmenwechsel um die Frage, ob das Bauen im Bestand dann Vorrang gegenüber Neubau erhalten soll, wenn für Letzteres ein Abriss nötig wird. Es gibt Pressure Groups in der Architektenschaft, die genau das fordern. Doch die (noch) geltende Rechtslage in Gestalt der Länderbauordnungen sei, so Schröer, traditionell dem Neubau verpflichtet. Mangels hinreichender Regelungen zu Umbau und Sanierung würden Bestandsbauten häufig abgerissen und durch neue Gebäude ersetzt. Der Bestandsschutz entfällt im Falle intensiver Modernisierung, nämlich dann, wenn keine Identität zwischen dem ursprünglich vorhandenen und dem umgebauten Gebäude mehr bestünde, der veränderte Bestandsbau nach den Eingriffen also anders aussieht als vorher. Die Folge: Mit der Aufhebung des Bestandsschutzes gelten Neubaustandards; ein Abriss erscheint dann wirtschaftlich sinnvoller als Erhalt.
Diesem Missstand will die Bundesregierung mit neuen politischen Rahmenbedingungen begegnen und setzt dafür auf eine Neubewertung der sogenannten Grauen Energie, mithin des Bestands und der Lebenszykluskosten. Zugleich jedoch verfolgt die Koalition das ambitionierte Ziel, pro Jahr 400.000 neue Wohnungen zu errichten, von denen ein Viertel mit öffentlicher Förderung entstehen soll. „Das ist ein Zielkonflikt, der sich nicht auflösen lässt“, befindet Anwalt Schröer kühl. Verschärfend komme hinzu, dass auch die staatlichen Förderprogramme fortan weniger dem Neubau, sondern Umbau und Sanierung zugute kommen.

Überfällig ist auch eine Anpassung des rechtlichen Rahmens, genauer: die Novellierung der Musterbauordnung. Dafür haben die „Architects for Future“ bereits konkrete Vorschläge formuliert, insbesondere mit Blick auf den Weiterbau im Bestand und Bestandsschutz, Abriss, die Stellplatzordnung, Freiraumplanung, Kreislaufwirtschaft und Genehmigungen für Typenbauten. Baurechtlich fiele vor allem ein differenzierter Bestandsschutz ins Gewicht, der endlich anerkennt, dass Alt und Neu in einem Gebäude integrierbar sind. Eine novellierte Musterbauordnung müsste konsequenterweise auch den Abriss klaren Regeln unterwerfen und die Genehmigung von Rückbaumaßnahmen von streng gefassten Voraussetzungen abhängig machen.
Allein die von Schröer skizzierten nötigen rechtlichen Anpassungen im Sinne einer Musterumbauordnung, die den Zielen einer Nachhaltigkeitswende am Bau gerecht werden könnte, lassen ahnen, dass es damit noch eine Weile dauern wird.
Von der Schweiz lernen?

Von den Eidgenossen lernen, heißt kompromissbereit werden, so fängt Patrick Gmür seinen kleinen Exkurs in das Bau- und Planungsgeschehen der Schweiz an. Eine Willensnation sei sein Land, betont er, in dem die sprachlichen und religiösen Unterschiede ebenso im Ausgleich integriert würden wie auch die Gegensätze zwischen Land und Stadt, Berg und Tal, Agrarwirtschaft und Industrie. Das Prinzip „Kompromisse statt Konfrontation“ findet selbst in der Zürcher Bauordnung seinen Widerschein, indem Gesetze immer einen gewissen Interpretationsspielraum einräumen, während Deutschland über kleinteilige Verordnungen alles verregelt. Gmür kennt die Planungskulturen dies- und jenseits der Alpen. Der Architekt und Stadtplaner war von 2009 bis 2016 Direktor des Amts für Städtebau in Zürich und hat gegenwärtig den Vorsitz des Städtebaulichen Gestaltungsbeirats in Stuttgart inne.
Wie sich der Umgang mit Bestand sowohl im kleinen Maßstab als auch auf Quartiersebene in der Schweiz gestaltet, schildert er entlang ausgewählter Projekte in Zürich.
Zum Beispiel Zürich
Diskussion
„Welche baukünstlerische Relevanz hat das Gebaute?“ Mit seiner ersten Frage wendet sich Moderator Jens Jakob Happ an Professor Paul Kahlfeldt, der sein im Jahr 2020 erschienenes Buch „Transformationen“ ausschließlich den zahlreichen Umbauprojekten seines Büros gewidmet hat und aus diesen Erfahrungen schlussfolgert, das Vergangene nicht nostalgisch zu überhöhen. Stattdessen, so Happ, ginge es darum, die Vergangenheit als Gegenwart ernst zu nehmen und daraus Kraft zu schöpfen. Das Überkommene solle in seiner Formkraft verstanden und für unsere Zeit nutzbar gemacht werden. So erhaben der Anspruch dieser Idee von Transformation, so ernüchternd die konservatorischen Anliegen einer Denkmalpflege, die nichts mehr fürchtet als genau diese Anverwandlung historischer Substanz. Brauchen wir deshalb nicht auch ein neues Verständnis von Denkmalwert und Denkmalpflege?

Für Kahlfeldt hat die Frage nach den Chancen von Transformation indes weniger mit der von ihm durchaus geschätzten Denkmalpflege zu tun, als vielmehr mit der Bezahlbarkeit solcher Maßnahmen und dem handwerklichen Können sowohl von Architekten als auch von Handwerkern. Eine grundsätzlichere Frage nach dem Umgang mit Vorhandenem berührt, so betont Moderator Happ, auch die Selbstverständlichkeiten der Moderne, genauer: Überfluss, Wohlstandsgewissheit, eine schier unbegrenzte Verfügbarkeit von Rohstoffen sowie das Streben nach Neuem bei gleichzeitiger Geringschätzung des Alten, mutmaßlich Überkommenen. Dass diese Moderne nicht nur selbst erschöpft ist, sondern auch ihre endlichen Grundlagen ausgelaugt und verbraucht hat, könnte auch in der zeitgenössischen Architektur zu einer Neubestimmung ihrer Produktionsvoraussetzungen führen. Und das hieße, Bestehendes nicht als überholt zu denunzieren, sondern als entscheidende Grundlage allen Bauens zu verstehen und zu nutzen.
Doch in der Debatte wird auch deutlich, dass diese Perspektive an manifeste Grenzen stößt. Denn das Ziel einer guten Planung, sei es höhere bautechnische Qualität, nachhaltigere Bewirtschaftung, höhere Dichte oder einfach mehr Wohnraum, lässt sich oft nur durch einen Ersatzneubau erreichen. Der Verlust von Bestand und damit wertvoller grauer Energie ist dadurch unvermeidlich. In manchen Fällen geht dadurch auch die sogenannte goldene Energie verloren, also die ästhetische Prägung und die Identität, die ein Standort durch Abriss von Bestand verliert. Gerade diese kaum bezifferbare und durch bauphysikalische Kennwerte nicht zu erfassende Einflussgröße eines Altbaus ist das, was seine nachhaltige Qualität ausmacht und jede Abriss-Absicht skandalisieren müsste.
Architektonische Qualität als entscheidender Faktor der Bestandssicherung
Einig sind sich die Diskutanten, dass Normen und Vorschriften nicht notwendigerweise architektonische Güte hervorbringen. Dem von den Architektenkammern und -verbänden beschworenen Wettbewerb erteilt Paul Kahlfeldt mit einem fast polemischen Verweis auf seine Heimatstadt Berlin eine Abfuhr. Mit Blick auf die zurückliegenden Jahrzehnte könne er kein aus einem Wettbewerb hervorgegangenes Projekt nennen, das eine nachhaltige ästhetische Qualität aufweise. Und er schiebt nach, dass Mies van der Rohe zeitlebens nicht an einem einzigen Wettbewerb teilgenommen habe und auch die Neue Nationalgalerie in Berlin eine Direktvergabe gewesen sei. Diabolisch verschmitzt kontert Patrick Gmür, dass auch dieses Bauwerk mit einem vorgeschalteten Wettbewerb möglicherweise noch besser hätte werden können. Nicht nur auf dem Podium wird herzlich gelacht.
Doch die Frage, ob der Wettbewerb tatsächlich der Königsweg zu guter Architektur und damit zu guten, lebenswerten und nachhaltigen Städten ist, bleibt damit unbeantwortet. Mehr verspricht sich Paul Kahlfeldt von einem Ansatz, der Erfahrung und Innovation koppelt, also in der Kooperation von qualifizierten und erfahrenen Büros mit entsprechenden Referenzen einerseits und jungen, innovativen Architekten andererseits, mithin Alt und Neu auch im Sinne der Berufspraxis.
Zwischen radikaler Bauwende und nachhaltiger Kontinuität
Die Schlussrunde gehört einem Glaubenssatz. Wie halten es Architekten und Stadtplaner mit der radikalen Bauwende und dem Verzicht auf Neubau? Aus Sicht des Juristen plädiert Thomas Schröer für einen nicht-ideologischen, spielerischen Umgang mit solchen Forderungen und setzt auf das kluge Argument anstatt apodiktischer Verbote. Paul Kahlfeldt, der sich mit seiner an der abendländischen Architekturgeschichte geschulten Entwurfshaltung vielen ideologischen Scharmützeln ausgesetzt sah, besteht mit der Gelassenheit des alten Kämpen auf fast exzentrischem Eigensinn: Ein gutes Haus sieht für ihn so aus wie ein gutes Haus auch schon vor 150 Jahren ausgesehen hat und sollte von Handwerkern in Handarbeit gebaut und – sehr wichtig – immer wieder repariert werden können.
In der eidgenössisch geschulten Bereitschaft zum Ausgleich plädiert auch Patrick Gmür für die Einzelfallentscheidung: Anstelle von pauschalen Verboten muss für jede Bauaufgabe nach einer individuellen, für den Standort und die Planung richtigen Lösung gesucht werden. Schon das wäre in der Tat radikal.
Weiterführende Links:
Eine Aufzeichnung der vollständigen Veranstaltung finden Sie auf YouTube .
Das Symposium wurde in einem Artikel der FAZ zum Thema (hier) und in einem Artikel der Welt (hier) aufgegriffen.
Text: Dörries, Fotos: CL
**
Wir weisen darauf hin, dass die Stiftungsarbeit des urban future forum e.V. ausschließlich durch Spenden finanziert wird. Als gemeinnütziger Verein sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen, um auch weiterhin interessante Veranstaltungen und Diskussionen zu ermöglichen.
Ihr finanzieller Beitrag ermöglicht es dem urban future forum e.V., wichtige Projekte zu realisieren, innovative Ideen zu fördern und weiterhin eine Plattform für den Austausch über zukunftsweisende Stadtentwicklung zu bieten. Mit Ihrem Engagement tragen Sie aktiv dazu bei, unsere Städte lebenswert, nachhaltig und zukunftsorientiert zu gestalten.
Wir möchten Sie ermutigen, Teil dieser wichtigen Initiative zu werden und gemeinsam mit uns einen Beitrag zur Gestaltung einer zukunftsfähigen urbanen Welt zu leisten. Ihre finanzielle Unterstützung macht einen entscheidenden Unterschied.
**